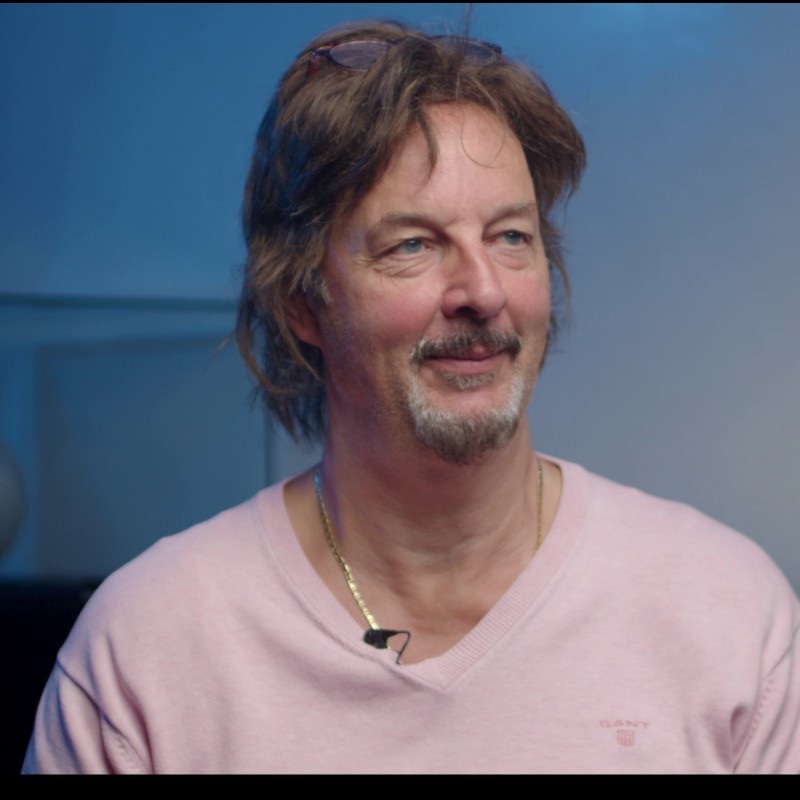Der Begriff Burnout ist in der Arbeitswelt weit verbreitet. 2018 hatten rund 176.000 Beschäftigte in Deutschland einen Burnout. Was genau versteht man unter diesem Krankheitsbild?
Prof. Dr. Stefan Kropp: Die Beschreibung des Phänomens geht auf den US-amerikanischen Psychologen Freudenberger zurück, der das Phänomen aus eigener Erfahrung nach langen Arbeitstagen als Psychotherapeut und ehrenamtlich Tätiger an sich selbst „entdeckt“ und publiziert hatte. Er betonte damals, dass Burnout keine psychische Erkrankung oder Neurose, sondern ein Phänomen eigener Art bzw. nur das Ergebnis anhaltender Überforderung sei. Nach der Erstbeschreibung durch Freudenberger beschäftigten sich viele weitere Arbeitsgruppen mit der Thematik. So entstand z.B. das Maslach Burnout Inventory, welches das Burnout Syndrom anhand der Dimensionen 1) Depersonalisierung mit den Symptomen Gleichgültigkeit, Zynismus und Distanz, 2) emotionale Erschöpfung mit den Symptomen Reizbarkeit, Anspannung und Antriebsschwäche und 3) Erleben von Misserfolg im Sinne von Sinnentleerung, Unwirksamkeit und Hyperaktivität beschreibt. Zusammengefasst haben wir ein Beschwerdebild, was die Emotionalität, Stresssymptome in allen Ausprägungsgraden, psychosomatische Reaktion, persönliche Erschöpfung und Kraftlosigkeit in sich vereint.
Wie kommt es zu einem Burnout, was sind die Auslöser?
Prof. Dr. Stefan Kropp: Mögliche Auslöser sind hohe Fremdbestimmung, ein eintöniger Alltag, partnerschaftliche Konflikte, hohe berufliche und persönliche Verantwortung, eine hohe Fürsorgeeinstellung bis hin zum Helfersyndrom, verbunden mit einer hohen und intensiven Sensibilität bei meist vorherrschender Daueranspannung.
Wie äußert sich der Burnout am menschlichen Körper? Welche Symptome treten auf?
Prof. Dr. Stefan Kropp: Im Bereich der Emotionalität stellen wir oft Gefühle von Hilflosigkeit fest, ein verringertes Selbstwertgefühl verbunden mit starken Stimmungsschwankungen, häufig depressiv ängstlichen Bildern gepaart mit Pessimismus und Fatalismus. Einhergehen kann dies oft auch mit einem Gefühl innerer Leere, Apathie oder Bitterkeit, aber auch vergesellschaftet sein mit Ärger und Aggressivität, Ungeduld, Reizbarkeit und Nervosität. Zusätzlich kann sich das Konsumverhalten ändern, beispielsweise stellen wir verstärktes Rauchen gegen nervöse Anspannungszustände fest, es kann vermehrter Alkoholkonsum auftreten, um quasi „zur Ruhe zu kommen“, zum Teil zeigt sich auch ein Missbrauch von Schmerztabletten, Schlaftabletten und sonstigen Beruhigungstabletten oder ein exzessiver Gebrauch von Süßigkeiten. Beim Essverhalten gibt es jegliche Veränderungsformen: es kann zu wenig, zu viel oder zu unregelmäßig sein. An psychosomatischen Reaktionen beobachten wir oft die Unfähigkeit zur Entspannung in der Freizeit, Schlafstörungen, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, vegetative Folgen wie Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, Engegefühl in der Brust, bis hin zu einer reduzierten Immunabwehr. Zusätzlich treten oft Stresssymptome in Form von Gedankenkreisen auf, es können unbestimmte Angstgefühle erlebt werden ebenso wie ständige Grübeleien, anhaltende Sorgen, aber auch das Gefühl, nicht mehr abschalten zu können. Aus dem neurologischen Spektrum beobachten wir zum Teil Schwindelanfälle, Ohrensausen, Kopfschmerzen, das Gefühl einen Schleier vor den Augen zu haben oder auch die Überempfindlichkeit gegen starkes Licht. Die sozialen Folgen sind oft die Verflachung und das Abnehmen von Freizeitbeschäftigungen und die Zunahme von Fernsehen und Online-Aktivitäten, sowie – mitunter auch infolge der Zunahme von Alkohol- und Zigarettenkonsum und des Missbrauches von Beruhigungsmitteln – auch partnerschaftliche und familiäre Schwierigkeiten bis hin zum häufigen Arbeitsplatzwechsel oder sogar dem sogenannten Ausstieg aus dem Beruf.
Welche Berufsgruppen sind besonders betroffen und warum ausgerechnet diese?
Prof. Dr. Stefan Kropp: Zuerst stellt man oft fest, dass es sich bei den beruflichen Tätigkeiten um zumeist einseitige Belastung handeln kann bei gleichzeitig hohen Konzentrationsanforderungen, einem hohen Tempo und viel Termindruck. Es kommen aber auch Situationen vor, in denen viele zwischenmenschliche Konflikte auftreten, was auch bei helfenden Berufen oft eine wesentliche Rolle spielt. Letztlich sind Berufsgruppen betroffen, bei denen eine hohe Fremdbestimmung in Kombination mit einem eintönigen Alltag und gleichzeitig hoher Verantwortung sowie einer hohen Fürsorgeeinstellung der Patienten auftreten. Wenn dann noch eine sehr einseitige Ausrichtung auf den Beruf vorliegt, kommt ein wesentlicher weiterer Risikofaktor hinzu. Ergänzend stellen wir bei Berufsgruppen, die eine geringe Berechenbarkeit ihrer Tätigkeit mit sich bringen, vielleicht auch mit Angst zu versagen in Verbindung mit Unsicherheit bezüglich der Eigenverantwortung und Aufgabenstellung, fest, dass dies Kriterien sind, die das Risiko erhöhen können.
Kann man einen Burnout präventiv vermeiden, wenn ja wie?
Prof. Dr. Stefan Kropp: Therapeutische Ansätze im Bereich der Persönlichkeit sind zuerst einmal die eigene mentale Einstellung zu Arbeit und zu Leistung zu klären und auch die Motive für das persönliche Engagement zu analysieren sowie eigene Kränkbarkeit zu bearbeiten, die möglicherweise beruflich eine Rolle spielen können. Weiterhin ist es hilfreich, auch Anerkennung außerhalb der beruflichen Kerntätigkeit zu suchen und sich nicht komplett auf diese zu fokussieren. Der Umgang mit Stress ist sehr individuell, das heißt ein persönliches Stressmanagement sollte entwickelt und gelebt werden. Wichtig ist es auch, eigene Überlastungsanzeichen zu erkennen und die Balance zwischen Spannung und Entspannung auch innerhalb der Arbeit aber auch innerhalb familiärer Zeiten sowie bei Hobbys kennenzulernen und zu pflegen. Empfehlenswert ist auch die Beschäftigung mit der eigenen Tagesleistungskurve, das heißt: wann sind die Phasen, in denen ich besonders viel leisten kann, wann sind Ruhepausen angesagt und wann muss ich spätestens ins Bett gehen, um am nächsten Tag ausgeruht zu sein. Da gibt es einerseits die eigene perfektionistische Einstellung, den Wunsch nirgendwo fehlen zu wollen, vieles parallel zu erledigen, alles sofort spontan und gleich zu machen, alle Fakten zu wissen, sich gleichzeitig nicht ablenken zu lassen, wichtige Dinge zu erledigen, dabei jederzeit ansprechbar zu sein: diese einzelnen Punkte sind unvereinbar mit einem entspannteren mentalen Zustand, aber es ist auch ein Zeitphänomen. Weitere wichtige Hinweise können sein, dass man sich Ziele setzt und sich entsprechend vorbereitet, Prioritäten setzt, Arbeitsschritte zusammenfasst und vereinfacht. Gleichzeitig ist es wichtig, eigene Erfolge als solche für sich zu erkennen, sich darüber zu freuen und diese nicht „unter den Tisch“ fallen zu lassen. Individuelle Strategien können auch darin bestehen, sehr klare Schwerpunkte festzulegen, nur mit realistischen Zeitplanungen zu arbeiten und, gerade in der heutigen Zeit ganz wichtig: sich nur auf eine Sache gleichzeitig zu konzentrieren. Der wesentliche Punkt ist tatsächlich den eigenen Perfektionismus abzulegen. Dazu gehört es auch, die eigenen Sinne für einfache Dinge wieder zu schärfen und sich insgesamt gesunde Strukturen zu schaffen, die den Alltag und die Abläufe betreffen. Letztlich ist es eine Symptomkonstellation der Moderne, die viele Verbindungen zur Depression hat und oft in eine solche münden kann. Dabei kommt es durch eine Überforderung von innen durch den Menschen selbst dazu, dass sich die Kraft verbraucht – die Erschöpfung wird meist durch den überhöhten eigenen Willen und die überhöhte eigene Anstrengung erzeugt – und auch die innere emotionale Anteilnahme für andere deutlich gefährdet ist. Moderne Entgrenzungsphänomene bei der Arbeit, in der Familie, im Hobby sind oftmals krankmachend, insbesondere weil die Ansprüche heutzutage oft sehr hoch sind und weil es auch unendlich viele Optionen gibt. Diese Optionen überfordern viele Menschen. Damit ist der Begriff Burnout als soziales Paradigma hoch aktuell, auch wenn es sich im Wesentlichen in den meisten Fällen wahrscheinlich um leichte bis mittelschwere oder schwere Depressionen handelt, hilft allein die Bezeichnung den Betroffenen die eigenen Bewältigungsstrategien zu reflektieren bzw. Hilfe zu suchen, eigene Fähigkeiten und Einstellungen sowie Werte zu hinterfragen bzw. zu prüfen. Damit gibt dieses „Krankheitsmodell“ Burnout Hinweise auf die Bedürfnisse, Ansprüche und Grenzen der Mitglieder unserer Gesellschaft in diesem wichtigen Kontext.
Wie lange dauert die Behandlung eines Burnout-Symptoms?
Prof. Dr. Stefan Kropp: Sollte es sich nicht nur um die Vorstufe einer Depression handeln, sondern eine manifeste depressive Erkrankung hinter dem Begriff Burnout stecken, so ist die Behandlung abhängig vom Schweregrad der Depression. Hier kommen ambulante, teilstationäre oder vollstationäre Behandlungen infrage. Neben der psychotherapeutischen Behandlung können in Einzelfällen gerade bei schweren depressiven Episoden auch medikamentöse Behandlungen erforderlich sein. Selbst bei einer vollstationären Behandlung muss man bei einer depressiven Episode mit einer mindestens mehrwöchigen Behandlung rechnen (oft 4-6 Wochen, z.T. länger).
Wann sollte man nach einem Burnout wieder anfangen zu arbeiten und sollte man danach wirklich erneut demselben Beruf nachgehen?
Prof. Dr. Stefan Kropp: Es ist wie mit dem Urlaub, der Dienstreise, einer Kur, einer Rehabilitation und anderen Maßnahmen: Man nimmt sich selbst immer mit und ist immer dabei, das heißt übersetzt: es geht im Wesentlichen um die Veränderung der eigenen Einstellungen, Anforderungen und Bewertungen und nicht in erster Linie um die Änderung einer beruflichen Tätigkeit. Auch bei einer rein ambulanten Behandlung spricht nichts gegen die weitere berufliche Tätigkeit, da nicht der Beruf an sich krank machend ist, sondern der Umgang, den ich mit meinem Beruf aber auch mit meinen Hobbys oder beim Familienleben insgesamt pflege. Keine berufliche Tätigkeit an sich kann man als Schuldigen bezeichnen. Vielmehr sind es oft wir als Persönlichkeiten, die sich gegebenenfalls eher für bestimmte berufliche Laufbahnen entscheiden, mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Herausforderungen, Gefahren, die dann hier möglicherweise auf uns lauern. Sich selbst zu ändern, eigene Gewohnheiten anzupassen, Einstellungen infrage zu stellen, ist niemals leicht, aber jederzeit und sofort möglich. Das ist viel wichtiger als eine bestimmte berufliche Tätigkeit infrage zu stellen oder aufzugeben. Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass das Thema Burnout ein gesellschaftliches Phänomen ist, was viele Menschen betrifft. Das heißt aber auch, dass es viele medizinische und therapeutische Angebote gibt, die hier hilfreich sein können. Von daher ist die grundsätzliche Prognose für alle Betroffenen positiv.